BGH dreht an der Sperrfrist: Eigenbedarf beginnt später
- Holbach News

- 3. Sept. 2025
- 2 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 4. Sept. 2025
Eigenbedarfskündigungen werden schwieriger, wenn vor dem Kauf eine GmbH & Co. KG im Grundbuch stand: Der BGH entscheidet, dass die Sperrfrist erst mit der Eigentumsumschreibung auf den privaten Käufer beginnt. Das stärkt Mieter – und zwingt Käufer, Verkäufer und Entwickler zu neuen Timelines und Preisen, erläutern FUCHSBRIEFE.

Wer eine vermietete Eigentumswohnung kauft, muss länger warten, bis er Eigenbedarf anmelden darf – jedenfalls wenn zuvor eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) Eigentümerin war. Der Bundesgerichtshof (BGH) stellt klar: Die Kündigungssperrfrist beginnt erst mit der Eigentumsübertragung an den privaten Käufer. In Städten wie München mit zehn Jahren Sperrfrist ist das marktprägend.
Über Jahrzehnte war es gängige Praxis, Mietshäuser in Wohnungseigentum aufzuteilen und an Selbstnutzer mit Aufschlag zu veräußern. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) bremst diesen Druck seit Langem mit § 577a: Eigenbedarfskündigungen sind nach Erwerb zunächst gesperrt – regulär drei Jahre, per Landesverordnung bis zu zehn. Was das konkret bedeutet, erläutern FUCHSBRIEFE.
Der Fall aus München
Der entschiedene Streitfall: Eine Mieterin wohnt seit 2004 in München. 2011 kaufte eine GmbH & Co. KG das Haus, 2012 wurden die Wohnungen nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG) aufgeteilt. 2016 verkaufte die Gesellschaft die streitige Wohnung an einen privaten Erwerber, der 2022 wegen Eigenbedarfs kündigte und Räumung verlangte.
Die Mieterin hielt die Kündigung für unwirksam. Ihre Argumentation: Die Sperrfrist nach § 577a BGB habe erst mit dem Erwerb der Eigentumswohnung durch den Käufer begonnen und laufe – wegen Münchens Zehn-Jahres-Verordnung – bis 2027. Der Käufer meinte, die Frist habe bereits mit der Umwandlung 2012 begonnen. Der BGH entschied am 6.8.: Fristbeginn ist der Eigentumserwerb durch den privaten Käufer; die Kündigung war 2022 verfrüht.
Rechtliche Leitplanken und die Ausnahme
Begründung des BGH: Der Bestandsschutz des Mieters steht im Vordergrund. § 577a Abs. 1 BGB knüpft an den Erwerb von Wohnungseigentum an; maßgeblich ist der Eigentumserwerb nach § 925 BGB. Erst wenn der erste Käufer Wohnungseigentum erlangt, läuft die Sperre.
Die besondere Konstellation des § 577a Abs. 1a BGB – Fristbeginn schon mit Veräußerung ohne vorherige Umwandlung – stammt aus dem Kampf gegen das „Münchener Modell“. Damals kauften Erwerbergemeinschaften ganze Häuser, meldeten noch vor der Aufteilung Eigenbedarf an und umgingen so den Mieterschutz. Die Gesetzesänderung sollte genau diesen Trick verhindern.
Warum die Ausnahme hier nicht greift
Im jetzt entschiedenen Fall gilt § 577a Abs. 1a BGB jedoch nicht. Denn eine GmbH & Co. KG kann selbst keinen Eigenbedarf geltend machen; Schutzlücken entstehen daher nicht bereits mit ihrem Erwerb. Der BGH reduziert den weiten Gesetzeswortlaut („Personengesellschaft“) auf seinen Sinn und Zweck.
Bemerkenswert: Der Senat wendet sich ausdrücklich gegen die herrschende Literaturmeinung. Das Gegenargument, eine GmbH & Co. KG könne immerhin mit „Verwertungskündigung“ Druck ausüben, hält das Gericht für unerheblich – darauf ziele § 577a BGB nicht primär ab.
Auswirkungen auf Marktakteure
Für Käufer bedeutet das: In Regionen mit verlängerten Sperrfristen beginnt die Uhr erst mit der eigenen Grundbucheintragung zu ticken. Wer selbst einziehen will, muss die Wartezeit einkalkulieren. Für Verkäufer und Projektentwickler verschiebt sich damit die Vermarktungslogik; Kaufpreise und Timelines müssen realistisch justiert werden.
Mieter wiederum gewinnen Rechtssicherheit: Ein früherer Gesellschaftserwerb löst keine Sperrfrist aus, die ihnen schaden könnte. FUCHSBRIEFE erklären: Entscheidend ist die Abfolge – Gesellschaft als Voreigentümerin, anschließend Verkauf an Privat – und der Zeitpunkt der Eigentumsumschreibung.
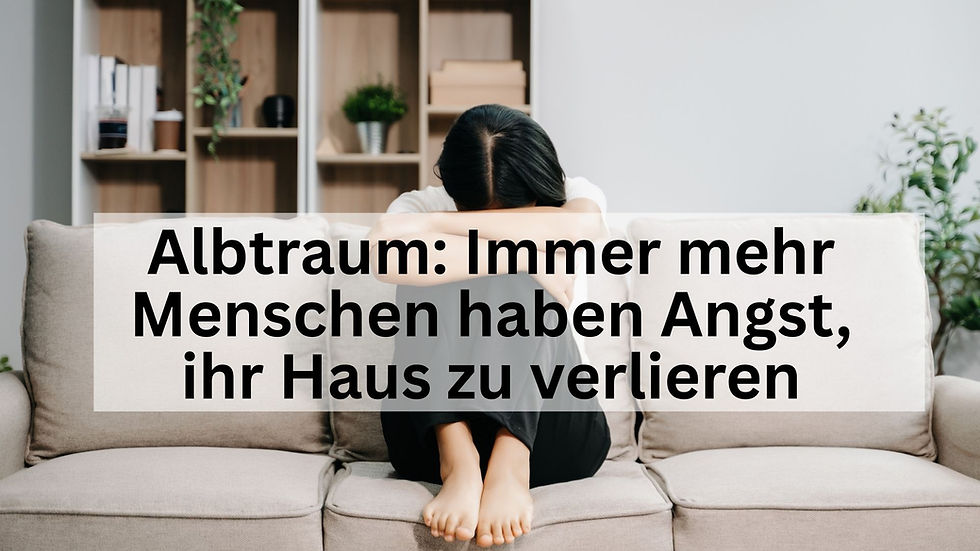


Kommentare